Zeitliche Abstimmung der Beweidung:
Die Beweidung der Magerrasen incl. felsigen Bereichen ist notwendig, um den Lebensraum zu erhalten, d.h. nicht verbuschen zu lassen. Dabei ist es von großer Bedeutung, die Beweidung zeitlich auf die Biologie des Apollofalters abzustimmen. Da die Puppen trittsicher unter der Erde bzw. unter Moos in Felsspalten u.ä. liegen, resultiert bei einer Beweidung in dieser Zeitspanne im Vergleich zu einer Beweidung während der Larvalphase eine Verringerung der Mortalität. Der erste Weidegang sollte deshalb Ende Mai / Anfang Juni stattfinden. Der zweite Weidegang wurde an das Ende der Flugzeit des Apollofalters, also auf Anfang/Mitte August gelegt. Dadurch konnte erreicht werden, dass sich zwischen diesen beiden Weidegängen die benötigten Saugpflanzen bis zur Blüte entwickeln und den Imagines zur Flugzeit zur Verfügung stehen (vgl. auch Geyer & Dolek 1995).
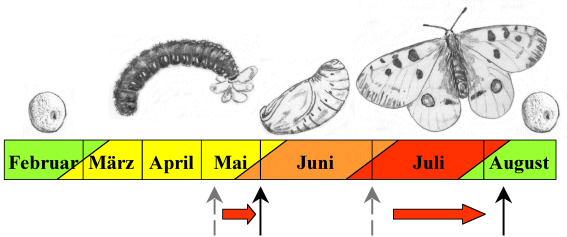
Anpassung der Weidetermine an die Phänologie des Apollofalters. Graue Pfeile: frühere, ungünstige Weidetermine; Schwarze Pfeile: angepasste Weidetermine, die zur Zeit der beweidungsunempfindlicheren Stadien (Puppe, Ei) erfolgen.
Die Aufnahme von Ziegen in die Herde ist besonders wünschenswert, da die Tiere im Gegensatz zu den Schafen bereitwilliger in steilere Felsbereiche klettern und stärker aufkommendes Gehölze verbeißen bzw. zurückdrängen. Außerdem folgen die Schafe den Ziegen in steilere Hangbereiche, so dass den Ziegen bei der "Felspflege" einen Mitzieheffekt bewirken.
Allerdings bedurfte es häufig einer gewissen Überredungsarbeit, die Schäfer davon zu überzeugen, auch Ziegen mit in die Herde aufzunehmen. So wurden Ziegen wegen ihrer angeblich schlechten Führigkeit und problematischen Einstallung im Winter ungern gehalten. Diese Probleme haben sich aber mittlerweile gelöst. (Weiterführendes zur Pflege und Entwicklung von Kalkmagerrasen und Felsen durch Schaf- und Ziegenbeweidung in Dolek et al. 2001)

Ziegen in der Steilwand.
Neben der Einführung bzw. der Anpassung der Beweidung lassen sich Apollofalter-Lebensräume z.B. auch durch Felsfreistellungen qualitativ verbessern oder wieder herstellen.
Insbesondere für nicht beweidbaren Felsen oder für Felsen mit starker Humsabdeckung ist eine Erstpflege durch maschinelle Eingriffe notwendig. Eine starke Humusauflage kann z.B. im Rahmen einer Feuerwehraktion abgespritzt werden. Bäume müssen unter Einhaltung gewisser Sicherheitsvorkehrungen gefällt und entfernt werden. Somit sind Felsfreistellung meist sehr arbeitsaufwändig, lohnen aber bei richtiger Auswahl dann auch die Mühe. Denn zum einen bieten sie dem Apollofalter wieder einen Lebensraum und zum anderen lassen sie sich auch schön anschauen.
Auch Magerrasen und Stützhänge können durch Entfernen des Baumaufwuchses wieder als Lebensraum nutzbar gemacht werden. Nach der Freistellung felsreicher Gebiete ist es wichtig, sofort mit der Beweidung einzusetzen, um die meist aus Altgräsern und wiederaustreibenden Gebüschen bestehende Vegetation zurückzudrängen. Auch sollte anschließend eine dauerhafte Pflege bzw. Beweidung einsetzen, um die Standorte langfristig zu erhalten.


